Führung: (Eine) Sicht der PH Zug
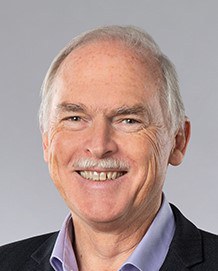
Welche Rolle spielt Führung und Klassenführung in der Ausbildung der künftigen Lehrerinnen und Lehrer? Clemens Diesbergen* ist Leiter der Ausbildungsgänge der PH Zug und beantwortet die Fragen von www.schulinfozug.ch.
Von Lukas Fürrer
Welche Sicht auf Führung oder Klassenführung hat die PH Zug?
Clemens Diesbergen*: Da muss ich gleich vorausschicken, dass es zu inhaltlichen Themen wie «Führung» natürlich nicht «die Sicht der PH» gibt. Meine Sicht ist individuell geprägt. Und es gibt an der PH Zug Kolleginnen und Kollegen, welche viel stärker mit dem aktuellen wissenschaftlichen Diskurs rund um das Thema «Führung/Klassenführung» vertraut sind. Selbst unter diesen Kolleginnen und Kollegen dürfte es allerdings keine absolute, einheitliche Sicht auf das Thema geben. Mit dem wissenschaftlichen Diskurs ist meist auch Kontroverse verbunden. Und so versuche ich gerne, aus meiner Perspektive auf die Fragen einzugehen, aber ohne einen allgemeinen Geltungsanspruch.
Noch vor wenigen Jahren war Klassenführung kein grosses Thema. Heute ist sie in aller Munde. Ist das so?
Da muss ich doch gleich die Aussage des ersten Satzes in Frage stellen, bitte entschuldige. Zwar war tatsächlich in meiner Ausbildung zum Lehrer am Lehrerseminar anfangs Achtzigerjahre Klassenführung kein Thema. Aber als ich selber Ende der Neunziger als Dozent in der Lehrpersonenausbildung mitzuarbeiten begann, gehörte der Themenbereich bereits fest zu den Ausbildungsinhalten. Und das ist ja jetzt doch schon eine Weile her. Der Leitbegriff war vielleicht anders und damit auch der Zugang zum Themenbereich und der Fokus. So wurden die Fragestellungen zur Klassenführung über längere Zeit eher unter dem Label «Disziplin» oder «Umgang mit Disziplin» diskutiert. Oder, wenn stärker auf die Probleme fokussiert, auch unter «Umgang mit schwierigem Verhalten». Aber die Grundfrage, wie ich als Lehrperson das Zusammenleben und -arbeiten gestalte in der Klasse, im Unterricht, ggf. auch im Schulhaus, wie man zu gemeinsamen Regeln kommt, deren Einhaltung dann auch einfordert und durchsetzt, wie man Einfluss nimmt auf Verhaltensweisen, die störend oder unangebracht sind, all dies ist schon seit vielen Jahren durchaus ein Thema in der Lehrpersonenausbildung.
War es dann etwas weiter zurück kein Thema, weil Führung damals in ihrer Anwesenheit abwesend war, um es mit Martin Heidegger zu sagen?
Es ist schon so, dass etwas, das funktioniert und in diesem Sinne «anwesend» ist, weniger Anlass gibt, darüber nachzudenken oder etwas in Frage zu stellen. Und so gilt eben auch das Umgekehrte: wenn Führung abwesend ist, also nicht gelebt wird, zeigen sich auch eher die Phänomene, welche das Nachdenken über Führung anregen oder gar erzwingen.
Ist eine Lehrperson eine Führungskraft?
Nebst vielem anderen, das eine Lehrperson auch noch ist, ist sie in einer bestimmten Weise auf jeden Fall auch Führungskraft. Sie leitet inhaltlich, setzt die konkreten Ziele und gestaltet, wie miteinander umgegangen und gearbeitet wird. Wo nötig, interveniert sie, greift sie korrigierend ein. Eine Lehrperson muss bereit sein, diese Rolle auch tatsächlich wahrzunehmen. Bereits bei unseren Informationsveranstaltungen für Studieninteressierte weisen wir darauf hin, dass die Übernahme von Führung zur Rolle der Lehrperson gehört. Man muss leiten wollen, wenn man Lehrperson werden will.

Was wird mit einer erfolgreichen Klassenführung erreicht?
Eine erfolgreiche Klassenführung schafft die Rahmenbedingungen, dass die Schülerinnen und Schüler sich wohl und sicher fühlen in der Klasse. Dies wiederum ist eine zentrale Bedingung, damit gut gelernt werden kann. Viel echte Lernzeit ist bekanntlich mitentscheidend für wirksames Lernen. Und natürlich profitiert auch die Lehrperson selber von einer erfolgreichen Klassenführung, da auch sie sich wohler fühlt und ihre Kernaufgabe, das Lernen der Schülerinnen und Schüler zu fördern, in den Fokus ihrer Bemühungen stellen kann.
Welche Führung anerkennen Schülerinnen und Schüler?
Es hat sich in der Praxis, aber auch in Untersuchungen, immer wieder gezeigt, dass sich Schülerinnen und Schüler in klaren Strukturen wohler fühlen und sie damit besser arbeitsfähig sind, als wenn viel Unruhe herrscht, die Dinge unklar sind und kein verlässlicher Rahmen für das Lernen und Zusammenleben besteht. Entsprechend schätzen Schülerinnen und Schüler Lehrpersonen, bei welchen die Regeln klar sind und welche diese auch durchsetzen. Ein wichtiger Faktor bei Kindern und Jugendlichen ist zudem das Gerechtigkeitsempfinden. So hiess es ja schon früher oft aus Sicht der Schülerinnen und Schüler, dass die Lehrperson «streng, aber gerecht» sein soll.
Glück ist, so soll es Seneca gesagt haben, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Gelegenheit zum Führen gibt’s in einer Schulklasse immer und vom Glück braucht’s jede Menge. Wie aber steht es um die Vorbereitung an der PH?
Viele Ausbildungselemente tragen dazu bei, dass die angehenden Lehrpersonen ihre Klassen führen können. Ein paar Beispiele: Im Verlauf des ersten Semesters absolvieren sie die Studienwoche «Lehrberuf», wo Aufgaben und Rolle der Lehrperson grundsätzlich reflektiert und diskutiert werden. Den Rahmen zu verstehen, in welchem man als Lehrperson handelt, ist wichtig. In dieser Studienwoche wird auch an der Auftrittskompetenz gearbeitet, ein wichtiges Werkzeug zum Leben von Führung. Entwicklungs- und sozialpsychologische Inhalte, welche im ersten Studienjahr auch zum Curriculum gehören, tragen zum Grundverständnis des Kindes, aber auch der sozialen Prozesse bei und bilden eine Orientierungsbasis für das Anleiten und Leiten der Lehrperson. Ganz konkret wird das Thema Führung im zweiten Studienjahr im Modul «Classroommanagement» bearbeitet. Hier erwerben die Studierenden theoretische Grundlagen der Klassenführung, bauen entsprechende Haltungen auf und bearbeiten sie konkrete Fallbeispiele und Anwendungssituationen. Das Modul soll sie letztlich dabei unterstützen, einen eigenen Führungsstil zu entwickeln und ihr Führungshandeln leben, aber auch begründen zu können. Selbstverständlich ist auch in der berufspraktischen Ausbildung, welche sich durch das ganze Studium zieht, die Klassenführung ein wichtiges Element, an welchem immer wieder gearbeitet wird und gerade hier können die Studierenden oft besonders viel von der Expertise der erfahrenen Praxislehrpersonen profitieren.
Wie entsteht überhaupt Raum für Klassenführung? Welche Rahmenbedingungen braucht’s?
Dies könnte man nun aus sehr unterschiedlichen Perspektiven betrachten, bspw. aus gesellschaftlicher Perspektive oder mit Fokus auf die Ebene Schule, auf die Zusammenarbeit im Kollegium oder auch mit Eltern. Aber zentral scheint mir schon die individuelle Ebene zu sein. Die Lehrperson braucht Wissen und eine reflektierte Haltung. Sie muss letztere und das sich daraus ergebende Handeln begründen können. Gestützt auf alles, was sie weiss und kann, muss sie auch über eine genügende Selbstsicherheit verfügen. Immer wieder habe ich in der Begleitung von Studierenden in der Berufspraxis erlebt, dass sie Hemmungen haben, konsequent zu reagieren und zu intervenieren, oft verbunden mit der Angst, damit die Sympathien der Schülerinnen und Schüler zu verlieren. Für viele war es dann ein Schlüsselerlebnis, dass das Leben von Führung, bspw. durch das konsequente Einfordern des Einhaltens von Regeln, das Verhältnis zu den Kindern ganz im Gegenteil positiv beeinflusst und gestärkt hat.
* Clemens Diesbergen hat nach einigen Jahren Berufstätigkeit als Primarlehrer an einer kleinen Dorfschule im Berner Oberland Pädagogik, Philosophie und Pädagogische Psychologie studiert und ein Nachdiplomstudium als Lehrer in Erziehungs- und Bildungswissenschaften absolviert. Seit dem Abschluss der Promotion in Pädagogik in den 90er Jahren ist in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung tätig, lange Jahre als Dozent, dann als Leiter einer Professur mit vierfachem Leistungsauftrag. Seit gut zehn Jahren leitet er die Ausbildungsstudiengänge an der PH Zug.