Auffangstrukturen bringen Entlastung

Am 25. Januar 2024 hat der Kantonsrat mit 65:0 Stimmen das neue Schulgesetz beschlossen. Inkrafttreten war am 1. August 2024. Neu gibt es Vorgaben zum Umgang der Schulen mit Verhaltensauffälligkeiten. Auffangstrukturen werden Pflicht.
Von Lukas Fürrer*
Problemverhalten ist ein Problem. So hat das der langjährige Leiter des schulpsychologischen Dienstes, Peter Müller, auf www.schulinfozug.ch auf den Punkt gebracht. Die Zuger Politik hat die Rufe aus der Praxis gehört. Während anderswo immer heftiger um die Integration gestritten wird, erhält sie in Zug ein «Ventil».
Und so lautet der neue § 33 Abs. 2a im Schulgesetz:
«Alle Gemeinden verfügen über ein Konzept zum Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit Verhaltensauffälligkeiten. Das Konzept umfasst ergänzend zu integrativen Unterstützungsmassnahmen auch ein Angebot zur kurz- und mittelfristigen Separation.»
Alle Gemeinden müssen über ein Konzept zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten verfügen. Zudem muss es in jeder Gemeinde separative Strukturen geben, damit Lehrpersonen rasch und unkompliziert auf Problemverhalten im Unterricht reagieren können. Solche Gefässe werden als Auffangstrukturen bezeichnet. Die Zuger Lehrpersonen hatten Auffangstrukturen schon bei der Pilotierung der Integration vor über zwanzig Jahren gefordert. In einer Mehrheit der Gemeinden wurden sie nach und nach eingeführt, aber nicht in allen. Dies ändert sich jetzt. Zusätzlich werden die bestehenden Lösungen auf Kompatibilität mit den neuen gesetzlichen Grundlagen und mit der Absicht des Kantonsrats überprüft. Zum neuen Paragraphen im Schulgesetz gibt es keine Vorgabe zum Umsetzungszeitpunkt. Bei dieser Sachlage kann - im stillschweigenden Sinn des Gesetzgebers - von einer zweijährigen Umsetzungsfrist ausgegangen werden. Spätestens per Schuljahr 2026/27 sollten alle Zuger Gemeinden über ein Konzept zum Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten und Auffangstrukturen verfügen.
Für die Erarbeitung und Überprüfung der Auffangstrukturen sind gemäss Kantonsrat die folgenden Eckpfeiler zu berücksichtigen:
- ganzheitlich-systemisch
- verbindlich
- verankert in der Schulkultur und im Schulalltag
- vielseitig und verzugslos umsetzbar
- vernetzt und abgestimmt
- [geregelte] Rahmenbedingungen (Prozesse, Dauer, Information etc.)
Zur Unterstützung werden diese Eckpfeiler vom Amt für gemeindliche Schulen in Indikatoren übersetzt und in eine Handreichung eingebettet. Ganzheitlich-systemisch bedeutet bspw., dass es mit einer Auffangstruktur alleine nicht getan ist. Es braucht eine gemeinsame Kultur für den Umgang mit Problemverhalten, es braucht eine gemeinsame Haltung. Und alles muss ganz konkret den Unterricht erreichen.
Im Bericht der Bildungskommission des Kantonsrats wird festgehalten, was Bildungsdirektor Stephan Schleiss gegenüber der Kommission zur Ausgestaltung der Auffangstrukturen und zur Dauer einer solchen Massnahme ausführte:
«Auf die Frage, was mit «kurz- und mittelfristig» gemeint sei, gab der Bildungsdirektor zur Antwort, dass darunter ganz sicher «unterjährig» zu verstehen sei. In der Praxis der Gemeinden, die bereits über solche Gefässe verfügen, handelt es sich oft um Tage bis Wochen. Auch ein wiederholter Besuch solcher Gefässe könne angezeigt sein, um den Unterricht in der Regelklasse zu schützen. Wichtig sei, dass solche Separationen schnell und unbürokratisch erfolgen können, ohne die vorgängige Konsultation von weiteren Fachstellen, weil es sich eben um temporäre Separationen handle. Ziel müsse immer sein, dass die Kinder in die Regelklasse reintegriert würden, wenn sie wieder «zur Ruhe gekommen» sind» (Bericht und Antrag der Bildungskommission vom 30. August 2023, S. 2).
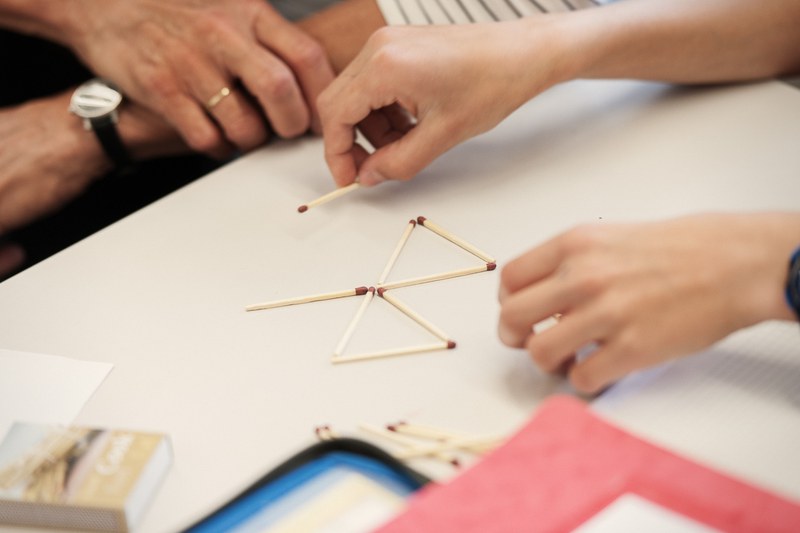
In einem ersten Schritt überprüft nun das Amt für gemeindliche Schulen die bereits bestehenden Lösungen. Wo noch Auffangstrukturen entstehen müssen, kann auf diese Erkenntnisse zurückgegriffen werden. Die Erwartung von Regierung und Kantonsrat ist klar und findet sich zum Beispiel auch im Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 23. Mai 2023 auf Seite 12. Die separativen Gefässe resp. temporären Auffangstrukturen sollen so ausgestaltet sein, dass auf Störungen schnell, niederschwellig und nachhaltig reagiert werden kann. An dieser Erwartung müssen sich die Lösungen der Schulen messen lassen. Orientierung für die Ausgestaltung bietet auch diese Kurzformel : schnell (aus dem Unterricht), unbürokratisch (ohne Formulare und Fachstellen) und eingebettet (in Schule und Konzept).
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen u. a. mit der Auffangstruktur an der Stadt Zuger Oberstufe oder auch den Schulinseln in Menzingen und Unterägeri ist die Bildungsdirektion überzeugt, dass die Gesetzesänderung die Schulen in ihrem Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten stärkt. Gute Auffangstrukturen entlasten die Lehrerinnen und Lehrer sowie ihre Klassen und fangen die betroffenen Kinder und Jugendlichen auf.